Mit Routinen brechen
Corona hat uns gezeigt, welche Innovationskraft im Bruch mit Gewohnheiten steckt. Ein Essay über Verhaltensökonomie.

Alles, ja fast alles, was über die Jahre selbstverständlich war, ist in Frage gestellt. Hilft uns da unsere grosse Adaptionsfähigkeit und unser erfinderisch-tätiger Forschungsgeist? Was bleibt nach den schlimmen, ja surreal geladenen Tagen von der Entschleunigung und unserer Hinwendung zum Existenziellen? Oder kehren wir unumwunden nach Katastrophenerfahrung und globaler Immunisierung in den Strudel der Beschleunigung zurück?

«Was wir in diesen schier surreal geladenen Tagen und Wochen erfahren, ist unter anderem eine Wendung ins Existenzielle.» © GettyImages
Schweizer Publizist und Buchautor. Er leitete das Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung von 1992 bis 2016 und ist unter anderem Präsident des Vorstands des Schweizerischen Instituts für Auslandforschung. Im Mai 2020 erschien sein neues Buch «Corona – Erzählung» im Verlag Kein & Aber.
Der Satz ist ein Wiedergänger. Er fällt regelmässig, wenn weltgeschichtlich bedeutsame Grossereignisse stattgefunden haben. Zu solchen global signifikanten Ereignissen zählen bekanntlich Kriege, Naturkatastrophen oder Völkerwanderungen, aber auch wissenschaftliche Entdeckungen und soziale oder technologische Revolutionen.
Und grosse Seuchen, sie ohnehin.
Der Satz trifft zu. Er sagt, dass solche Erschütterungen die Lebensbedingungen dramatisch verändern. Dass fortan mit neuen Uhren gemessen werden muss, oder – wie im Jahr 1945 – sogar eine Stunde Null ausgerufen wird.
Der Satz trifft nur bedingt zu. Denn trotz solch ungeheuren Einbrüchen ist der Mensch ein Genie der Adaptationen. Das heisst nichts anderes, als dass er zwar das Neue erkennt und sich rascher oder langsamer zu eigen macht, dabei aber zugleich auf das Alte oder das Konstante zurückgreift. Er greift in den Vorrat seiner Erfahrungen, seiner Überzeugungen, seiner Geschichten, um überhaupt wieder weitermachen zu können. Nach den Krisen. Nach den Katastrophen. Nach den Seuchen.
Was heisst das für die Seuche des wohlklingenden Namens Corona?
Es heisst zunächst nichts anderes, als dass wir tatsächlich – und allerdings nicht zum ersten Mal – mit einem Vorgang konfrontiert sind, der fast alles, was sich über die Jahre hinweg wieder einmal an Gewöhnung und Eingewöhnung entwickelt hat, in Frage stellt.
Ein Riss geht durch den Vorhang. Dahinter zeigen sich die Gespenster. Sie tanzen einen dämonischen Rhythmus, und weil wir längst global vernetzt und informiert sind, sehen wir auch viele schreckliche Dinge, die uns früher vorenthalten geblieben wären. Wir sind in Echtzeit dabei.
Globalisierte Echtzeit ist vor allem Vergleichszeit. Denn sogleich beginnen wir zu spekulieren, ob es «bei uns» auch noch «so schlimm» kommen könnte. Ob «wir» besser oder schlechter gerüstet sind als «diese» oder «jene». Und schliesslich, ob «die Menschheit» an einem Kreuzweg steht.
Die Vernunft sagt, dass die Nebenfolgen des Fortschritts – zu denen man auch «Corona» zählen darf – nicht immer, aber häufig durch den Fortschritt selbst wenn nicht gebannt, so doch gebändigt werden können. Nichts kann den erfinderisch-tätigen Geist davon abhalten, unentwegt zum Besseren hin zu wirken, auch wenn immer massivere Nebenfolgen möglich werden. Nebenfolgen, die im schlimmsten Fall den Fortschritt selbst aufzehren könnten.
Ein solch apokalyptisches Ende ist nicht ausgeschlossen.
Doch bisher hat es nicht stattgefunden. Noch nicht, sagen die Warner und Mahner. Die aber ihrerseits selten für nachhaltig machbare Alternativen gut sind.
Natürlich darf, ja muss man «Corona» als eine Warnung verstehen. Vor allem dann, wenn man – nicht unrealistischerweise – damit rechnen muss, dass Viren von wesentlich schärferer Beschaffenheit auftauchen können. Aber auch dann gilt: Nur Wissenschaft, Technologie, kluge Politik und soziale Disziplin werden ihnen die Stirn bieten können.
«Corona» ist schlecht. In jedem Fall schlecht.
«Aber was wir in diesen schier surreal geladenen Tagen und Wochen erfahren, ist unter anderem eine Wendung ins Existenzielle.»
Das mag pathetisch klingen. Ist es jedoch nicht. Denn in der Quarantäne, so schlimm sie sein kann, vertiefen wir unseren Innen- und Selbstbezug. Wir finden in uns zurück. Denken dies oder jenes, lesen dies oder jenes, telefonieren mit diesen oder jenen, aber in der Regel etwas anders als zuvor. Nämlich mit feinerem Ohr und besonnenen Reaktionen.
Eine Seuche, so furchtbar sie ist, entschleunigt die Zeit.
Die Sache ist nämlich anderseits die, dass wir Menschen der modern aufgeklärten Gesellschaften unentwegt in den Strudeln der Beschleunigung leben. Alles geht immer schneller. Auch dafür ist unser Adaptationsgenie gerüstet, aber es befindet sich meistens im Dauerstress.
Jetzt herrscht eine Stille der Welt mit «Corona». Das verblüffende Resultat dieser Pandemie ist, dass Zeiten zurückzukehren scheinen, die an vielen Orten längst museal geworden waren. Die Lebenswelt schleicht wieder wie im Krebsgang.
Mit Blick auf die Schäden ist das wiederum schlecht. Für die Wirtschaft kann es fatal sein. Nur ein paar Wochen – bisher. Und welche Folgen.
In solchen Zeiten ist guter Rat buchstäblich teuer. Zugleich kann nicht überraschen, dass Heerscharen von Experten auftreten, die – je für sich oder in Gruppen – alles immer besser wissen. Oder besser gewusst hätten.
Der Philosoph René Descartes hat für solche Situationen eine spezielle Moral entwickelt. Sie ist, nach Descartes, eine morale par provision. Einer, der sich im Wald verirrt hat, kann nicht wissen, wohin er gehen soll. Deshalb trifft er eine Entscheidung und geht dann rüstig in dieser Richtung.
Das gilt für die grosse Politik und nicht weniger für den Alltag. Entscheidungen sind nötig, die nicht in allem, mitunter nicht einmal in Vielem vollkommen letztbegründungsfähig sind.
Allerdings müssen sie – Hand in Hand mit der Entwicklung der Krise – auch fortwährend revidiert und angepasst werden können. Das ist klar. Der Verirrte, der am Horizont endlich das Feld sieht, kehrt nicht plötzlich zurück in den Wald, um von vorne zu beginnen.
Postskriptum: Während ich diesen Text im Home Office schreibe, das mir jetzt manchmal wie ein Raumschiff, manchmal wie ein umgedrehtes Aquarium vorkommt, bin ich doch zuversichtlich, dass wir auch die jüngste Krise in absehbarer Zeit bewältigt haben werden. Sogar könnte die Krise vielfältige Lernprozesse begünstigen. Sie könnte das Bewusstsein für den Umgang mit den Ressourcen Zeit und Nachhaltigkeit vertiefen. Oder anders gesagt: Wer kräftig lernt, sich Zeit für das Wichtige zu nehmen, hat dabei nicht nur sich selbst, sondern auch Verantwortung in der Welt gefunden.
Erst die Pandemie, dann der Krieg: Sie brachten Fragen aufs Tapet, denen wir uns bislang nicht stellen mussten – oder stellen wollten. Dazu gehören auch Themen, die unsere ganz persönliche finanzielle Vorsorge und Sicherheit betreffen:
Wie weit soll ich meine Hypothek bis zur Pensionierung amortisieren? Ist die Hypothek zu hoch, ist sie womöglich schwer zu finanzieren. Ist sie zu tief, wird allenfalls viel Cash gebunden und die Steuerlast unnötig erhöht.
Klar ist: Es gibt kein absolutes «Richtig oder Falsch». Je nach persönlicher Situation und Pensionskassenlösung gilt es unterschiedliche Faktoren zu berücksichtigen. Wir erläutern, welche Konsequenzen Ihre Entscheidung haben kann.
Ein freiwilliger Einkauf in die Pensionskasse gilt als attraktiv, weil er steuerliche Vorteile mit sich bringt. Aber es gibt auch Einschränkungen und Risiken, die man beachten sollte.
Wie viel sollen Ihre Liebsten einst bekommen? Das neue Erbrecht tritt per 1. Januar 2023 in Kraft. Es vergrössert die Möglichkeiten, den Nachlass nach eigenen Wünschen zu planen.
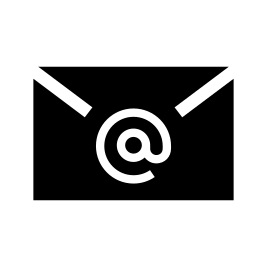
Wer sind wir? Wie leben wir heute? Und wie wird das Coronavirus unser Leben verändern? Die Frage nach der Zukunft bewegt die Gesellschaft mehr denn je. Antworten suchen Ingenieure, Mediziner, Politiker und jeder einzelne von uns. Der Essay «Tanz der Dämonen in globalisierter Echtzeit» ist einer von zahlreichen Beiträgen, die das «Leben nach Corona» aus einem neuen, inspirierenden Blickwinkel beleuchten. Wir publizieren ihn hier als Teil unserer Serie «Impact».